In der Straßenbahn sehe ich immer junge Frauen, die Bücher lesen. Ich versuche immer, herauszufinden, welches Buch sie lesen. Aber ich finde das nie raus. Die halten das Buch nicht still, daß ich den Titel entziffern könnte.
Mir gegenüber sitzt ein kleines Mädchen. Sie stellt ihrem Vater viele Fragen. Sie sieht etwas, und sie fragt ihren Vater, was es damit auf sich hat. Der Vater beantwortet alle Fragen seiner kleinen Tochter.
Warum die Schienen da herumliegen? Weil die alten Schienen weggemacht werden und dafür die neuen Schienen verlegt werden. Warum? Weil die neuen Schienen besser sind als die alten, erklärt der Vater geduldig.
Das Mädchen sieht ein Kaninchen über die Böschung hoppeln, zeigt mit dem Finger dahin und sagt: „Da ist ein Tier gelaufen.“ Die ganze Welt muß begriffen werden.
Aber ich verstehe die Frauen nicht, die zum Lesen in eine Straßenbahn einsteigen. Ich gehe doch auch nicht zum Lesen ins Kino.
Schlagwort-Archive: Öffentliche Verkehrsmittel
Encore, encore!
Aus der Serie „Komische Gespräche“
„Was haben Sie für ein Hobby?“
„Ich sammle Spechte.“
„Sie sammeln Spechte?“
„Ja. Gestern habe ich ein sehr seltenes Exemplar eines Glasspechts erworben.“
„Ein Glasspecht?“
„Jawohl. Sie haben sicherlich schon einmal vom Schwarzspecht, vom Grünspecht und vom Buntspecht gehört. Diese drei Species der Familie Spechte bilden zusammen die Obergattung der Baumspechte, auch Holzspechte genannt. Die Baumspechte beziehungsweise Holzspechte hacken Höhlen in Baumstämme, um darin ihre Nester zu bauen. Im Wald ist das charakteristische Geräusch, das durch das Aushöhlen von Holz entsteht, kilometerweit zu hören. Auch wenn man einen Specht selten sieht, hat man doch schon oft Spechte beim Holzbearbeiten gehört. Auch der Glasspecht macht sich durch sein artspezifisches Geräusch bemerkbar: ‚Teckteckteck‘ hört man, wenn der Glasspecht mit seinem Schnabel auf Fensterscheiben klopft. Die Glasspechte und die Holzspechte bilden zusammen die Unterfamilie der Realspechte. Wohingegen die Unterfamilie der Raketenspechte…“
„Realspechte? Holzspechte? Glasspechte? Raketenspechte? Teckteckteck? Jetzt hören Sie mal zu!“
Tipptipptipp! (tippt mit dem Zeigefinger der linken Hand gegen die Stirn).
Sagense mal, kommt Ihnen das nicht irgendwie bekannt vor? Ja, richtig!
„Raketenspecht“ könnte auf einen Vorfall in dem US-amerikanischen Weltraumraketenabschußzentrum Cape Canaveral zurückzuführen sein. Dort hatte bei einer startbereiten Rakete ein Specht in den Hitzeschild über hundert Löcher reingepickt. Der Start mußte verschoben werden.
Wieso Schokolade? Wieso Eis?
Ich saß in Holland auf einem Bahnsteig und wartete auf den Zug. Es war ein schöner sonniger Sommertag.
Ein Zeitungsverkäufer (in weißer Jacke) schob einen Wagen mit lauter Zeitungen auf dem Bahnsteig hin und her. Niemand wollte eine Zeitung kaufen. Da kam er auf die Idee, etwas auszurufen, was die Leute ihm wohl eher abkaufen würden: „Schokolade! Eis!“
Der hatte gar keine Schokolade und gar kein Eis. Der hatte nur Zeitungen. Das, was er hatte, wollte keiner kaufen. Da hat er eben etwas verkaufen wollen, was er nicht hatte.
Das ist das klassische Dilemma der griechischen Tragödie.
Oder glaubte er, der Kunde, der eine Tafel Schokolade bestellt, würde es nicht merken, wenn ihm stattdessen das Wall Street Jounal in die Hand gedrückt wird?
Nächste Station: Jetzt aber!
Unterwegs zu freundlichen Menschen
 So fängt es vielversprechend an (Duisburg Hauptbahnhof).
So fängt es vielversprechend an (Duisburg Hauptbahnhof).
 Wir sind eingestiegen. Der Zug könnte also losfahren.
Wir sind eingestiegen. Der Zug könnte also losfahren.
 Oberhausen durchqueren wir kühn (und beschauen uns das Ruhrgebiet im Vorbeifahren).
Oberhausen durchqueren wir kühn (und beschauen uns das Ruhrgebiet im Vorbeifahren).
 Die Wolken verfinstern sich über der Energie. Das heißt: Wir fahren in Dortmund ein.
Die Wolken verfinstern sich über der Energie. Das heißt: Wir fahren in Dortmund ein.
 Ausgestiegen in Wischlingen. Weiterfahren lohnt sich nicht.
Ausgestiegen in Wischlingen. Weiterfahren lohnt sich nicht.
 Noch vor wenigen Jahren war rechts von der Straße eine schöne Auenlandschaft mit meterhohem Gras. Inzwischen ist alles mit Bäumen bewachsen – irgendwie schade.
Noch vor wenigen Jahren war rechts von der Straße eine schöne Auenlandschaft mit meterhohem Gras. Inzwischen ist alles mit Bäumen bewachsen – irgendwie schade.
 Was ist das? Was ist das?
Was ist das? Was ist das?
Die CDU auf einem Festival der DKP?
Richtig! Es handelt sich um die portugiesische Coligacao Democratica Unitaria, das Wahlbündnis aus Kommunisten (Partido Comunista Portugues (PCP)) und Grünen (Partido Ecologista Os Verdes (PEV)).
Ich würde sogar CDU wählen – aber nur, wenn ich Portugiese wäre.
Ich erzähle jetzt jedem, daß ich mir an einem Infostand der CDU eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen bestellt habe.
 Zwischendurch mal kann man durch den schönen Wald gehen und das Fest von Weitem anschauen. Früher, als wir noch mit einem eigenen Büchertisch drei Tage lang beim UZ-Fest waren, brauchte ich ab und zu eine solche Ruhepause.
Zwischendurch mal kann man durch den schönen Wald gehen und das Fest von Weitem anschauen. Früher, als wir noch mit einem eigenen Büchertisch drei Tage lang beim UZ-Fest waren, brauchte ich ab und zu eine solche Ruhepause.
Daß es am Samstag, dem 28. Juni 2014 in Dortmund regnen wird, hatte ich schon vor einem halben Jahr vorhergesagt.
Wo sind eigentlich die vielen Wasservögel hin, die früher den schönen See bevölkerten?
 Klaus der Geiger, auf der Gitarre begleitet von seiner Tochter.
Klaus der Geiger, auf der Gitarre begleitet von seiner Tochter.
 „Hier stehe ich, du kannst nicht anders.“
„Hier stehe ich, du kannst nicht anders.“
„Man wollte mich trennen von meiner Partei. Es ist ihnen nicht gelungen.“
 Es spricht Patrick Köbele, Vorsitzender der DKP.
Es spricht Patrick Köbele, Vorsitzender der DKP.
 Ulrich Sander spricht für die VVN.
Ulrich Sander spricht für die VVN.

 Esther Bejarano (89) war Mitglied im Mädchenorchester von Auschwitz. Ihr Auftritt mit der deutsch-türkisch-italienischen Rapgruppe Microphone Mafia ist fester Bestandteil des UZ-Festes.
Esther Bejarano (89) war Mitglied im Mädchenorchester von Auschwitz. Ihr Auftritt mit der deutsch-türkisch-italienischen Rapgruppe Microphone Mafia ist fester Bestandteil des UZ-Festes.
Konstantin Wecker hält dem Fest unserer kleinen Partei seit vielen Jahren die Treue.
Es war ein schöner verregneter Tag unter freundlichen Menschen, unter Menschenfreunden.
Mit der Eisenbahn durch das Ruhrgebiet
Heimfahrt vom UZ-Pressefest in Dortmund nach Duisburg. Das ist nicht die südliche Linie über Bochum und Essen, sondern die nördliche. Wir unterhalten uns über dieses & jenes. Aus einem Lautsprecher kommt alle paar Minuten die Stationsansage.
„Nächster Halt: Dortmund Mengede.”
Ich sage: „Dortmund Mengede? Warum nicht?”
„Nächster Halt: Castrop-Rauxel Hauptbahnhof.”
„Wat? Dat nennen die ‚Hauptbahnhof‘?”
„Nächster Halt: Herne.”
„Ach, sind wir schon in Herne?”
„Nächster Halt: Wanne-Eickel.”
„Wanne-Eickel? Ich dachte, wir wären schon in Gelsenkirchen.”
„Nächster Halt: Gelsenkirchen.”
„Gelsenkirchen? Ich dachte, wir wären schon in Katernberg.”
Einem jungen Kerl, zwei Meter, zwei Zentner, der sich durch sein Äußeres als Schake-Nullvier-Verehrer zu erkennen gibt, wird es zu viel:
„Also, paß ma auf: Jetz kommt Gelsenkirchen, dann Katernberg, dann Altenessen, dann Bergeborbeck, dann Dellwig, dann Oberhausen, und dann Duisburg. Klar?”
Er lehnt sich zurück, mustert mich von oben bis unten und sagt: „Besoffen bisse ja nich, nä? Wohl eh‘r bekifft, wa?”
 ..
..
Warum mit mir nicht zu rechnen ist, wenn zu den Waffen gerufen wird
Bei der Lesung am 17. Dezember in der Spinatwachtel habe ich diesen Text vorgelesen:

„Statt zu klagen, daß wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dafür dankbar sein, daß wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.“
Dieter Hildebrandt
Was ich 1967 in die Begründung meines Antrags auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen hineingeschrieben habe, weiß ich nicht mehr.
Wäre ich gezwungen, meine Entscheidung, den Dienst in der Bundeswehr zu verweigern, noch einmal zu begründen, würde ich auf folgende Zeitungsmeldung verweisen:
„Schwarzer Postbote in Thüringer Dorf schikaniert. Wegen seiner schwarzen Hautfarbe mußte die Post einen Briefträger in Vachdorf im Süden Thüringens versetzen. Bewohner des 800-Einwohner-Dorfes hatten den Afrikaner immer wieder bei seiner Arbeit behindert; u.a. schickten sie ihn wissentlich in falsche Richtungen, wenn er nach dem Weg fragte. Anschließend beschwerten sich die Bürger über den Boten. Daraufhin versetzte die Post den Mann aus Mosambik mit dessen Zustimmung zum Fahrdienst. Der Mann werde bei der Post als zuverlässige und gute Arbeitskraft geschätzt, betonte eine Sprecherin.“
Daß der gute Mann den Wunsch hatte, in diesem Loch nicht mehr Dienst zu tun und für diesen Abschaum der Menschheit keine Post mehr auszutragen, ist nur zu gut zu verstehen. Daß dieses Kaff aber nicht zur Strafe in Dreckdorf umbenannt und für drei Monate vom Postverkehr ausgeschlossen wird bei anschließender Verdoppelung des Portos, ist mir unbegreiflich.
Das Dorf liegt im Süden Thüringens, befand sich also 40 Jahre lang außerhalb des Geltungsbereichs jener Freiheit, die die Soldaten der Bundeswehr unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen haben. In dem Unrechtsstaat DDR waren die Bewohner dieses Dorfes 40 Jahre lang gezwungen, auf die Völkerfreundschaft Eide zu schwören; und die Stasi kam gucken, ob die auch wirklich schwören. Das haben die dann auch getan und dabei mit den Zähnen geknirscht. Aber ungebrochen blieb ihre Hoffnung, eines Tages der Freundschaft der Völker abzuschwören und endlich zu ihrem nationalen Wesen zurückzukehren, welches seinen höchsten Ausdruck darin findet, daß sie jemanden, der nach dem Weg fragt, absichtlich in die Irre führen.
Was muß daran verteidigt werden? Müßte nicht in jedem vernünftigen Menschen die Sehnsucht wachsen, daß dieses Dorf mitsamt dem Pack, das darin haust, ugandischen, birmanischen oder peruanischen Truppen in die Hände fällt?
Jahrzehntelang wurde uns in besorgtem Ton vorgehalten, unsere Bundesrepublik mitsamt ihrer Freiheit (Wege falsch zu beschreiben) sei von bösen Feinden bedroht, die nur darauf warten, hier einzumarschieren und uns unter ihre Herrschaft zu zwingen.
Diese deutsche Nation, die zwei Weltkriege vom Zaun brach und Millionen Menschenleben vernichtete, diese deutsche Nation, die die größte Gefahr darstellt, die die Menschheit je gekannt hat, entblödet sich nicht, sich selbst als Opfer einer Gefahr darzustellen. Diese Nation, der ich zutraue, daß sie zu einem dritten Weltkrieg bereit sein könnte und abermals Millionen Menschen vernichten würde, weil sie von dem Drang besessen ist, die Welt unter ihre Leidkultur zu zwingen, sorgt sich ernsthaft, unter fremde Herrschaft gezwungen zu werden. Das allein ist ein Aberwitz.
Aber selbst wenn es stimmen würde, selbst wenn andere Gewehr bei Fuß stehen würden, um über Deutschland ihre Herrschaft zu errichten – wäre das wirklich so schlimm?
Deutschland hat Fremdherrschaft erlebt. Vor 2000 Jahren waren es die Römer. Sie brachten uns die urbane Kultur und die Wasserleitung – und übrigens auch die wunderschöne Hauskatze. Sie bereicherten unsere Sprache mit Wörtern wie Nase, Name, Nummer, Mauer, Fenster und Schrift und führten hier solche Grundsätze ein wie „nulla poena sine lege“ und „dubio pro reo“.
Vor knapp 200 Jahren kam der Kaiser Napoleon mit seinen Franzosen. Sie brachten uns die Müllabfuhr, das Zivilrecht und die universellen Ideen von Freiheit und Gleichheit, auf die die Germanen nie von selbst gekommen wären. Napoleons Vorboten, die Hugenotten, haben den Deutschen doch erst das Essen mit Messer und Gabel gezeigt (was die Deutschen den Franzosen niemals verzeihen werden). So wie die Römer in Germanien die Steinzeit beendeten, beendete Napoleon in Deutschland das Mittelalter, seine Herrschaft hinterließ hier wenigstens den Hauch einer Vorstellung von gutem Essen, gutem Wein und guten Manieren. Die Franzosen haben uns Deutschen doch erst Kultur beigebracht.
Mag sein, daß die, die über dieses Land Fremdherrschaft errichteten oder errichten wollten, dies nicht uneigennützig taten. Aber für uns ist immer etwas Gutes dabei abgefallen. Den Kaffee verdanken wir der Belagerung Wiens durch die Türken.
Gewiß: Die verteidigungsbereiten Herrschaften werden das abtun als Schönfärberei. Fremdherrschaft sei schließlich keine Weihnachtsbescherung. Die Wirklichkeit sähe doch ganz anders aus. Ja, stimmt. Aber hier haben wir das Phänomen, das jeder Psychologe kennt: Von sich auf andere schließen. Wenn je im Zwanzigsten Jahrhundert Fremdherrschaft die Hölle war, dann war es die Herrschaft der Deutschen über andere. Das ist der Alptraum der Deutschen: daß andere mit ihnen umspringen könnten wie sie es mit anderen tun beziehungsweise tun würden wenn sie könnten. Würden – nach dem, was Deutsche der Menschheit im Zwanzigsten Jahrhundert zugefügt haben – andere über dieses Land eine Fremdherrschaft errichten, die die Protagonisten der Vaterlandsverteidigung an die Wand malen: bedauerlich wäre es. Aber ungerecht könnte ich es nicht finden.
Dabei ist es doch noch in frischer Erinnerung, wie segensreich fremde Herrschaft über die Deutschen ist. Man braucht gar nicht auf die Römer, Türken und Napoleon zu verweisen. Wie war es, als die Weltkriegs-Alliierten in unser Land eindrangen? Es war ein Aufatmen! Schluß mit den Verdunkelungen und der Angst im Luftschutzkeller, Schluß mit der Allmacht der Blockwarte und den Einberufungsbefehlen für Kinder! Als Deutsche von deutschen Führern beherrscht wurden, gab es Entbehrung und „Durchhalten“. Als die Amis kamen, gab es Schokolade und Zigaretten.
Meine Tante hat mir, als ich ein Kind war, ihre erste Begegnung mit amerikanischen Soldaten geschildert. Sie saß an einem Tisch, um sie herum die Soldaten. Sie stellten ihr eine Büchse Ananas hin und legten einen Dosenöffner daneben. Sie grinsten und kicherten. Diese naiven, gutmütigen Jungens waren gerührt, als die junge Frau zum ersten Mal in ihrem Leben die unbekannte Frucht genoß, Ananas aus Hawaii.
Nie zuvor wurden Besiegte von den Siegern so human behandelt wie die Deutschen von den Amerikanern. Die Amerikaner hielten die Deutschen für fähig, Demokratie zu lernen.
Kann man sich vorstellen, daß zur Wahrung des Deutschtums das Hören guter Musik mit der Todesstrafe bedroht wurde? Unter fremder Herrschaft konnte man endlich das Radio aufdrehen. Der Badenweiler Marsch und die Sondermeldungs-Fanfare verschwanden. Man hörte „In the Mood“ und „Moonlight Serenade“. Ja, Glenn Miller war auch Militärmusik. Aber selbst darin war etwas von dem kostbarsten Geschenk der Amerikaner an die Welt: Der Blues.
Gewiß: mit der Niederlage, die ein Sieg der Menschlichkeit war, hat das Volk der Deutschen sich nie abgefunden, wie ein Blick in die Chronik der Jahre 1989/90 zeigt, jener Jahre, in denen die Rationalität der Nationalität weichen mußte. Mit der Gewißheit, daß die Niederlage keine endgültige war, ließ es sich gut einrichten. „Wir sind wieder wer“. Die Schinkenspeckgesichter spießbürgerlicher Selbstzufriedenheit kenne ich.
Kindheit im Jahrzehnt nach dem vorläufigen Zusammenbruch ist mir auch noch gut in Erinnerung. Daß Kinder überhaupt Rechte haben, ist eine Idee der jüdisch-bolschewistischen Frankfurter Schule, die die Nation immer noch ganze zwei Jahrzehnte sich vom Leibe zu halten verstand. Man muß sich mal Klassenfotos aus den 50er Jahren angucken: Als hätten sich die Erwachsenen an den Kindern für 1945 rächen wollen. Der Gang zum Friseur war ein Antreten zum Appell. Allein: Es klappte nicht. Die Generation der in der Mitte des Jahrhunderts Geborenen mißriet gründlich. Für sie kam alles Gute aus der Fremde: Von Donald Duck bis zu den Beatles, wehrkraftzersetzende Blue Jeans, und undeutsche Helden wie James Dean: Helden, die nicht trotzig ihr Kinn der Weltgeschichte entgegenreckten, sondern sich voller Melancholie herumdrückten. James Dean führte nicht vor, wie man siegt, sondern wie ein Loser seine Würde zu wahren versucht.
Das größte Werk der mißratenen Generation war der Massenimport volksfremder Kultur: Gangsterfilme, Comic-Strips, Urwaldmusik. Man vergleiche Hemingway mit Hans Habe, Erica Jong mit Hera Lind, Grateful Dead mit den Fischerchören, Zappa mit Heino, Groucho Marx mit Mario Barth, Columbo mit Derrick, Jeanne Moreau mit Ruth Leuwerik, Madonna mit Nina Hagen, die Französin Romy Schneider mit der Deutschen Marika Rökk, „Casablanca“ mit „Briefträger Müller“, Gershwin mit Wagner!
Ist also etwas dran, daß die sogenannten „68er“ diese Gesellschaft „gründlich zivilisiert“ haben? Komisch klingt dieses Zitat der Antje Vollmer vor allem deshalb, weil sie es just in dem Moment in die Welt setzte, als die arrivierten Teile der „68er“-Kultur sich der Wende zum Guten Deutschen anschlossen. Doch in der Tat hatte die deutsche Linke ihre vergleichsweise beste Phase, als sie – als veritabler Bürgerschreck – mit dem deutschen Gemüt ihren Schabernack trieb. Kritische Vernunft und Humanität können sich in dieser Gesellschaft nur entfalten, wenn sie sich am Nationalempfinden funkensprühend reiben. Sonst kommt nix dabei raus.
Daß die Leichtigkeit des Seins unerträglich wäre, ist eine Schnapsidee, die man eigentlich von einem deutschen Idealistenkopp erwartet hätte. Diese Leute basteln ja immer noch an dem Vorurteil, daß Kultur etwas Wichtigeres sei als Zivilisation. Dabei ist es gerade der Unernst, der hierorts gern als „Oberflächlichkeit“ mißverstanden wird, mit dem das Leben sich erleichtern läßt, jawohl: erleichtern. Klüger, als Schwierigkeiten zu trotzen, ist, sie überhaupt zu vermeiden. Bequeme Sitze in der Straßenbahn sind für das allgemeine Wohlergehen wichtiger als das tiefgründelnde Grübeln über die Frage, warum wir über den Sinn des Lebens nachdenken.
Abwehr gegen Fremdherrschaft war immer Abwehr gegen Versuche, die Germanen zu zivilisieren. Die anderen führten mit den Deutschen immer Besseres im Schilde als die Deutschen mit sich selbst.
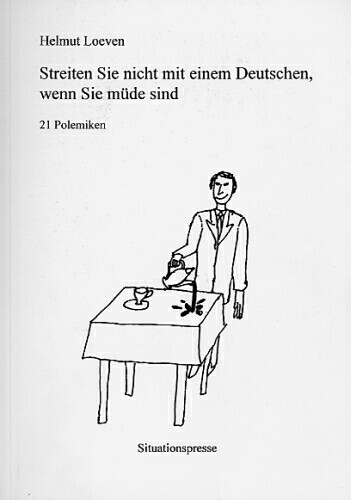 Aus „Streiten Sie nicht mit einem Deutschen, wenn Sie müde sind“.
Aus „Streiten Sie nicht mit einem Deutschen, wenn Sie müde sind“.
Eloge auf einen Terroristen
Die Bundeskanzlerin hat den verstorbenen Nelson Mandela einen Titanen der Gerechtigkeit oder Giganten der Menschlichkeit oder sowas in der Art genannt. Andere Würdenträger äußerten sich ähnlich.
Irren sie sich da nicht?
Als Nelson Mandela noch im Gefängnis war, hörte man von den Staatsfiguren, die sich jetzt elogierend gegenseitig überbieten, nichts dergleichen. Damals war Nelson Mandela ein Terrorist, der sein Volk zum gewaltsamen Umsturz des Apartheidregimes anstachelte. Seine Freilassung zu fordern war der kleinen radikalen Minderheit überlassen, den sogenannten Sympathisanten, also uns.
Wir Staatsfeinde unterscheiden uns von den Staatsträgern dadurch, daß wir schon gegen die Apartheid waren, als es sie noch gab. Sie unterscheiden sich von uns dadurch, daß sie die Freilassung Mandelas erst richtig fanden, als sie erfolgt war.
 Bei der Demonstration gegen Apartheid und für die Freilassung Mandelas auf dem Münsterplatz in Bonn trat der Staat in Erscheinung, aber anders als jetzt. Die Polizei trat so martialisch auf, wie ich es zuvor noch nie gesehen hatte.
Bei der Demonstration gegen Apartheid und für die Freilassung Mandelas auf dem Münsterplatz in Bonn trat der Staat in Erscheinung, aber anders als jetzt. Die Polizei trat so martialisch auf, wie ich es zuvor noch nie gesehen hatte.
Die jederzeit in der Lage sind, politisches Widersprechen mit der Polizei einzudämmen, sind nicht schlauer geworden. Das erkennt man daran, daß sie sich für ihr Diktum von einst nicht entschuldigen. Sie irren sich nie, sondern folgen immer der Opportunität, die es ihnen heute nahelegt, Abglanz aufzusaugen. Sie können nicht aufhören zu lügen.
Als wir mit dem Bus der Bonner Verkehrsbetriebe zum Ausgangspunkt der Demonstration fuhren, sagte der Busfahrer die Station an, und er fügte hinzu: „Ich würde am liebsten mitgehen.“
Vom Löschen des Durstes
Das Fußballspiel zwischen dem Duisburger Spielverein und Eintracht Gelsenkirchen im Wedaustadion, Zweite Liga West, Saison 1962/63, sah ich gemeinsam mit meinem Cousin und meinem Onkel. Ein spannendes Spiel übrigens, das letzte der Saison. Der Gewinner würde in die neugegründete Regionalliga aufsteigen, der Verlierer in die Amateurklasse absteigen. Es ging ruppig zu auf dem Spielfeld, drei Platzverweise, Duisburg gewann 2:1.
In der Halbzeitpause wurde ich auserkoren, drei Coca zu holen. Coca Cola. Mittlerweile bezeichnet man die coffeinhaltige Brause als „Cola“. Damals sagte man zu dem braunen Erfrischungsgetränk schlicht „Coca“, was die konkurrierenden Marken Afri Cola und Pepsi Cola ins Hintertreffen brachte.
Drei Coca also. Man bekam sie an einem Getränkestand für ein paar Groschen, abgefüllt in kleinen Fläschchen aus Weißglas, mit Pfand, wie sich das gehört.
Um den Getränkestand herum standen viele Männer, die alle finster dreinblickten, weil es ja ein spannendes Fußballspiel war. Auch der Getränkemann schaute finster. Viele waren vor mir dran, und ich mußte warten, bis sie alle ihr Getränk bekommen hatten. Es gab nicht nur Cola, sondern noch was anderes.
„Wat willz du?“
„Ne Fanta.“
„Un wat kriss du?“
„Ne Coca – ach nä, gib ma lieber auch ne Fanta.“
Der nächste. „Coca oder Fanta?“
„Ach, gib ma ne Fanta.“
„Fanta“ hörte und sah ich an diesem Tag überhaupt zum ersten Mal. Das mußte wohl sowas ähnliches wie „Bluna“ sein, eine Orangenlimonade. Die Fantafläschchen, genauso groß wie die Colafläschchen, waren bräunlich und ließen darin eine orangefarbene kohlensäurehaltige Flüssigkeit vermuten. Und diese Limonade gewann hier in Windeseile das Wohlgefallen der um ein Erfrischungsgetränk Anstehenden.
„Ach, gib ma keine Coca, gib ma lieber ne Fanta.“
Fanta war der Bestseller des Tages.
„Coca? Nä, laß ma. Gib ma ne Fanta.“
„Nää! Immer dat Coca-Zeug! Gib ma ne Fanta!“
„Richtig!“ rief einer. „Gib ma ne Fanta.“
Irgendwann war ich an der Reihe. Und ich bestellte:
„Drei Coca.“
Alle drehten sich nach mir um. Was war geschehen? Da hatte doch so’n 13jähriger Lümmel am Getränkestand tatsächlich drei Coca Cola bestellt! Wo doch all die deutschen Männer sich gefunden hatten, um tapfer entschlossen zu sein, Fanta zu trinken, weniger um ihren Durst zu löschen, sondern um nicht Coca zu trinken!
Ich, mit der ganzen Schlichtheit meines Gemütes, fand mein Verhalten gar nicht ungewöhnlich. Ich kaufte ein Produkt, das hier angeboten wurde. Ich war in der dezidierten Absicht hierhergekommen, drei Cola zu kaufen, und in dem allgemeinen Aufwallen einer Stimmung sah ich keinen Anlaß, mein Kaufbegehren zu revidieren. Ich tat nichts anderes als das, was ich mir vorgenommen hatte, ohne Rücksicht darauf, daß über die anderen etwas gekommen war, was mir, das spürte ich deutlich, als Fehlverhalten angekreidet wurde, ein „Fehler“ übrigens, den ich im Laufe meines Lebens immer wieder beging.
Ich bekam auch meine drei Coca Cola, niemand legte dagegen Einspruch ein, aber ich meinte, ein unzufriedenes Brummen zu vernehmen. Mit drei Flaschen in zwei Händen bahnte ich mir den Weg durch die Umstehenden, deren Seitenblicke ich als bedrohlich empfand. Ich übertreibe nicht. Immerhin war ich inmitten entschlossener Coca-Verschmäher aus der Reihe getanzt.
Ich hatte, wie auch später in meinem Leben immer wieder, mich von einer nationalen Aufwallung nicht mitreißen lassen, die an jenem Tage Gestalt fand darin, daß deutsche Männer sich dem Zwang widersetzen, nach dem verlorenen Krieg Coca Cola trinken zu müssen. Meine Treue zu der coffeinhaltigen Brause bestätigte den Argwohn, daß mit der „Jugend von heute“ kein Krieg zu gewinnen sei, was – zumindest in meinem Fall – ja auch stimmte und immer noch stimmt.
Die Nachgeborenen werden das kaum verstehen, aber so war das damals wirklich. Es war die Zeit, in der Straßenbahnschaffner nicht Bedienstete eines Dienstleistungsunternehmens waren, sondern zur Obrigkeit gehörten. Der Erwerb einer Eisenbahnfahrkarte nach Kassel war gleichbedeutend mit dem Ersuchen an den Staat, nach Kassel reisen zu dürfen.
In einer Straßenbahn erlebte ich, wie der Schaffner mit seiner Losung „Noch jemand ohne Fahrschein?“ durch den Waggon patrouillierte und einen bestimmten Fahrgast eines Staatsverbrechens verdächtigte: „Hast du einen Fahrschein?“ Dieser Fahrgast, der in jener Zeit die Unverfrorenheit besaß, 15 Jahre alt zu sein, zeigte frohgemut seinen gültigen Fahrschein vor. Daraufhin der Schaffner: „Da hast du aber gerade nochmal Glück gehabt.“
Wem nichts vorzuwerfen war, der hatte „gerade nochmal Glück gehabt“.
Ich habe das erlebt: Ich saß in der Straßenbahn. Es regnete. Die Bahn hielt an einer Haltestelle, wo ein paar Leute in dem Wartehäuschen sich untergestellt hatten. Der Schaffner herrschte die Leute in dem Wartehäuschen an: Sie sollten entweder einsteigen oder weggehen. Das Wartehäuschen ist nicht für alle da, sondern nur für die Leute, die auf die Bahn warten. Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder einfach…
Ich habe das erlebt: Ich stand am Schalter im Postamt. Vor mir war einer dran, der wollte 100 Briefmarken zu 10 Pfennig. Der Schalterbeamte: „Wofür brauchen Sie die?“ Er hat dem Mann die Briefmarken nicht gegeben, weil der in einem Akt des zivilen Ungehorsams Weiterlesen
Bilder von einer Wanderung
Weil letzten Samstag so ein schönes Spätsommerwetter war, entschloß ich mich: Nein, die Balkontür werde ich heute doch nicht streichen (sondern nächstes Jahr), und stattdessen unternehme ich heute noch einmal eine meiner Wanderungen.
 Und wohin habe ich mich im menschenleeren Bus begeben? Zur Kupferhütte!
Und wohin habe ich mich im menschenleeren Bus begeben? Zur Kupferhütte!
 Strahlend der Himmel und finster die Industriekulisse. Links im Bild: Plakat zu einer Wahl, die vor Jahren stattfand.
Strahlend der Himmel und finster die Industriekulisse. Links im Bild: Plakat zu einer Wahl, die vor Jahren stattfand.
 Strandpanorama soll ein Lichtblick sein? Weghier.de (denkt vielleicht jemand. Ich nicht).
Strandpanorama soll ein Lichtblick sein? Weghier.de (denkt vielleicht jemand. Ich nicht).
 Die dahinschwindende Industrie läßt auch mal eine Lücke, in die ein Baukran paßt. Das Auto fährt dahin, wo niemand ist.
Die dahinschwindende Industrie läßt auch mal eine Lücke, in die ein Baukran paßt. Das Auto fährt dahin, wo niemand ist.
 Blaues Schild: Lange Nacht der Industrie (oder: bange Nacht?).
Blaues Schild: Lange Nacht der Industrie (oder: bange Nacht?).


 Nasse Straße, obwohl es seit Tagen nicht geregnet hat.
Nasse Straße, obwohl es seit Tagen nicht geregnet hat.

 Einige Verwaltungsgebebäude sind an zahlreiche kleine Firmen vermietet worden. Einige Fenster werden noch geputzt.
Einige Verwaltungsgebebäude sind an zahlreiche kleine Firmen vermietet worden. Einige Fenster werden noch geputzt.
 Hochspannung!
Hochspannung!
 In diesem Kabüffchen konnte man sich besonders schön auf den Feierabend freuen (mit Thermoskanne).
In diesem Kabüffchen konnte man sich besonders schön auf den Feierabend freuen (mit Thermoskanne).
 You’ll never…
You’ll never…
 …never…
…never…
 …never…
…never…
 …reach the sky!
…reach the sky!
 Alle Tore geschlossen.
Alle Tore geschlossen.
 Wo kommt denn der weiße Rauch her? Wurde da noch ein Papst gewählt? Reicht der eine nicht?
Wo kommt denn der weiße Rauch her? Wurde da noch ein Papst gewählt? Reicht der eine nicht?
Oder hat der letzte beim Verlassen der Halle vergessen, die Industrie auszuschalten?
 Da geht’s zum Rhein.
Da geht’s zum Rhein.

 Die Montanindustrie rostet hier vor sich hin.
Die Montanindustrie rostet hier vor sich hin.
 Wo kein Eingreifen der Verschönerung diente, entwickelt sich eine eigene Ästhetik – etwa, wenn die Vegetation sich selbst überlassen bleibt, oder, wie hier, die Ästhetik der Industrieanlagen und ihres langsamen Verfalls.
Wo kein Eingreifen der Verschönerung diente, entwickelt sich eine eigene Ästhetik – etwa, wenn die Vegetation sich selbst überlassen bleibt, oder, wie hier, die Ästhetik der Industrieanlagen und ihres langsamen Verfalls.
Niemand hat die Gebäude gebaut, die Rohre verlegt und die Wolken am Himmel zurechtgeschoben, damit es schön aussieht.
Die Farbe des Geldes – Reichtum abschaffen?
Reichtum abschaffen? Oder doch besser: Reichtum für alle?
Das klingt verrückt. Soll man jedem Geld in die Tasche stecken? Soll jeder Millionär sein? Das gab es schon mal: 1923. Da war jeder sogar Milliardär, im Jahr größten Elends.
„Reichtum für alle“ – um sich darunter etwas vorzustellen, muß man die Vorstellung aufgeben, daß „Reichtum“ eben nur das ist, was ein Einzelner für sich hat.
 „Reichtum für alle“ heißt nicht, daß jeder viel Geld hat, sondern daß niemand viel Geld braucht, daß die Straßenbahn öfter fährt und ein Fahrschein Zwanzichfennich kostet, daß der öffentliche Personennahverkehr nicht ausgedünnt und verteuert wird, sondern ausgebaut und verbilligt, daß in den Schulen mehr Lehrer kleinere Klassen unterrichten, daß der Anschaffungsetat der Stadtbibliothek nicht gestrichen, sondern erhöht wird, daß die Kommunen keine Defizite haben, sondern Überschüsse, die zur Verbesserung der Lebensqualität verwendet werden, daß Jugendeinrichtungen nicht geschlossen, sondern neue eröffnet werden und so weiter und so weiter. Und das Hallenbad in Wanheim soll nicht nur nicht geschlossen werden, sondern das Stadtbad in Hochfeld auf der Heerstraße, das vor Jahren abgerissen wurde, soll an derselben Stelle wieder aufgebaut werden, und zwar genauso, wie es damals ausgesehen hat.
„Reichtum für alle“ heißt nicht, daß jeder viel Geld hat, sondern daß niemand viel Geld braucht, daß die Straßenbahn öfter fährt und ein Fahrschein Zwanzichfennich kostet, daß der öffentliche Personennahverkehr nicht ausgedünnt und verteuert wird, sondern ausgebaut und verbilligt, daß in den Schulen mehr Lehrer kleinere Klassen unterrichten, daß der Anschaffungsetat der Stadtbibliothek nicht gestrichen, sondern erhöht wird, daß die Kommunen keine Defizite haben, sondern Überschüsse, die zur Verbesserung der Lebensqualität verwendet werden, daß Jugendeinrichtungen nicht geschlossen, sondern neue eröffnet werden und so weiter und so weiter. Und das Hallenbad in Wanheim soll nicht nur nicht geschlossen werden, sondern das Stadtbad in Hochfeld auf der Heerstraße, das vor Jahren abgerissen wurde, soll an derselben Stelle wieder aufgebaut werden, und zwar genauso, wie es damals ausgesehen hat.
Wie man den Coitus interrumpieren kann
In der Straßenbahn: Eine etwa 18jährige, die ihre Reisebegleiter unentwegt mit Wat-is-Fragen unterhält.
„Wat schwimmt auf‘m Teich und fängt mit Z an? Zwei Enten.“ Im Sekundentakt geht das so: „Wat is – wat is – wat is schwarzweiß und macht peng? – Wat is gelb und läuft durch die Wüste? Woran erkennt man einen Elefanten in einem Kirschbaum? Wat is der Unterschied zwischen…“ Von Hauptbahnhof bis Huckingen geht das so. Gucken Sie mal auf den Stadtplan, wie lange die erzählt hat.
Irgendwann wird es mir zu viel, und ich sage:
„Mädchen, du hast noch ganz andere Vorteile als dein Repertoire an solchen Denksport-Aufgaben. Überlaß das doch irgendwelchen Klassenstrebern, die auch mal lustig sein wollen. Bei dir hingegen könnte das deine eigentlichen Vorteile arg ins Hintertreffen gelangen lassen. Hoffentlich fragst du nicht während des Geschlechtsaktes ‚Wat is der Unterschied zwischen einem Krokodil? Je grüner desto schwimmt et‘.“
Nein, das habe ich ihr nicht gesagt. Das habe ich nur gedacht.
Ein Samstag im Jahre 1969
Das war gar nicht im Jahre 1969, fällt mir gerade ein. Das war im Jahre 1970, und zwar im Februar. Es hätte aber auch im Jahre 1969 sein können, dann aber im November, denn im November ist ein ähnliches Wetter wie im Februar. Jedenfalls ging man damals mit den Samstagen um, als gäbe es genug davon.
Wir waren an diesem Samstag am frühen Nachmittag verabredet, um uns in die Politische Ökonomie einzuarbeiten. Das wurde „Schulung“ genannt. Die „Schulung“ sollte stattfinden bei Dietmar Ernst, also in Neudorf. Der Dietmar Ernst paßte in unsere KPD/ML-Gruppe genauso wenig hinein wie die meisten von uns. Leute wie ihn pflegte man als „zornige junge Männer“ zu bezeichnen. Er war ein paar Jahre älter als ich, wohl schon Mitte 20, trug wie fast alle männlichen KPD/ML-Mitglieder dieses Alters einen Stalin-Schnurrbart, war wirklich ein „zorniger junger Mann“, lachte nie, brachte aber unentwegt andere zum Lachen mit seinen kunstvoll vorgetragenen Sarkasmen. Er wohnte auf der Blumenstraße in einem riesigen Altbau (Foto) im Dachgeschoß, das ebenfalls riesig war, bestehend aus sehr vielen kleinen Zimmern.

Wir hatten uns also zu fünft dort eingefunden, vier Männer und eine Frau. Anne fehlte noch. Sie wollte etwas später kommen. Ich sollte sie zur verabredeten Zeit von der Straßenbahnhaltestelle abholen.
Anne war meine Freundin. Sie war die hübscheste von allen. Sie hatte wunderschönes langes dunkelbraunes Haar. Jedem gefiel sie, mancher begehrte sie, aber mich hatte sie erhört. Niemand hatte gewußt, daß ich in sie verliebt war, aber alle hatten gewußt, daß sie in mich verliebt war, bloß ich nicht. Wir haben dann aber doch zueinander gefunden und waren ein richtiges Traumpaar.
Anne war sehr gescheit und von unbändiger Neugier auf alles, was man wissen und erfahren kann. Man hätte ihr über alles mögliche etwas erzählen können, über Astronomie, über Geologie oder über isländische Literatur – sie hätte sich das alles aufmerksam angehört.
Sie hatte eine Schwäche: Sie hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Den Weg von ihrer Haustür zur Straßenbahnhaltestelle fand sie zwar, auch gelang es ihr, an der richtigen Station aus der Bahn auszusteigen. Aber den Weg von der Haltestelle Neudorfer Straße zur Blumenstraße (etwa hundert Meter geradeaus) konnte sie nur finden, wenn man sie an der Hand nahm und führte. Sie hatte mir eingeschärft, sie zur verabredeten Zeit an der Haltestelle abzuholen.
Ich ging also zur Haltestelle. Aus der Bahn, mit der sie kommen wollte, stieg sie aber nicht aus. Sie wird sie wohl verpaßt haben, dachte ich, und wartete auf die nächste. Mit der nächsten kam Anne auch nicht, auch nicht mit der übernächsten. Es wurde ein langes Warten.
Während ich wartete, fand sich an der Haltestelle ein alter Mann ein, der – das war leicht zu vermuten – zu denen gehörte, die über keine Wohnadresse verfügen. Sein Mantel war sehr abgetragen, die zahlreichen Plastiktüten, die er mit sich trug, enthielten wohl all seine Habseligkeiten. Auf dem Haupt hatte er kaum noch Haare, dafür hatte er einen langen Bart. Für die Comic-Figur „Herr Natürlich“ von Robert Crumb hätte er das Modell sein können.
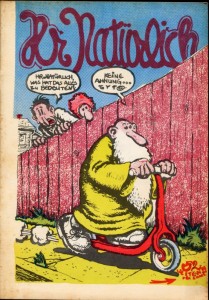
Als die nächste Straßenbahn eintraf, begann er, hastig die Plastiktüten aufzuheben. Als dann endlich all seine Tüten hochgehoben waren, war die Bahn schon abgefahren, und er ließ sie wieder zu Boden sinken. Das wiederholte sich noch ein paar mal. Nie war er schnell genug mit dem Zusammenraffen der Tüten, immer fuhr die Bahn ohne ihn ab. Mir fiel auf, daß die Bahnen, in die mit seinen Tüten einzusteigen er nie schaffte, von verschiedenen Linien waren und auf verschiedenen Wegen zu verschiedenen Stationen fuhren. Er wollte mit der Straßenbahn wegfahren, und es kam ihm offensichtlich nicht darauf an, mit welcher und wohin.
Nachdem er auf diese Weise wohl schon ein halbes Dutzend Straßenbahnen verpaßt hatte, begann er, mit durchdringender Stimme und in erheblicher Lautstärke ein Lied zu singen, das auch nach der vierzigsten Strophe noch nicht zu Ende war. Der Text war dermaßen bescheuert, daß er nur selbstgedichtet gewesen sein konnte. Die erste Zeile lautete:
„Was ist das Leben heut‘ so schwer! Man findet keine Ruhe mehr!“
Die Botschaft des Liedes läßt sich etwa so zusammenfassen: Wie man es auch dreht und wendet, das Leben bringt doch nur Verdruß.
„Hast du einen kleinen Laden, hast du auch so deine Plagen!“
Die beiden älteren Damen, die da auch auf eine Straßenbahn warteten, sagten zwar nichts, aber die Indigniertheit über den lautstarken Balladenvortrag war ihnen anzumerken. Als der Sänger dessen gewahr wurde, stellte er sich vor eine der beiden Damen hin, nahm eine Boxerstellung ein, tänzelte mit erhobenen Fäusten vor ihr hin und her und ließ die Fäuste durch die Luft sausen, immer die Nase der Dame knapp verfehlend. Die Damen waren fassungslos über das Geschehen. Weniger fürchteten sie sich, von einem Boxhieb getroffen zu werden. Aber es war ihnen furchtbar unangenehm, daß da einer sich dermaßen aufführte.
Ich verbrachte wohl eine Stunde an der Haltestelle und entfernte mich dann, so daß ich nicht weiß, wie die Geschichte mit den vergeblichen Abreiseversuchen ausging, und ich Ihnen nicht sagen kann, welche Wendung schließlich dazu führte, daß der Mann mit seinen Tüten jetzt nicht mehr an der Haltestelle steht. Anne war nicht gekommen; es wird ihr wohl – so vermutete ich – etwas dazwischengekommen sein. Ich ging also wieder dorthin, wo nun mit Verspätung die Schulung auf der Grundlage des Lehrbuchs der Politischen Ökonomie (Dietz-Verlag 1955) beginnen sollte.
Als wir uns in das Studium der Produktionsweise in der Urgemeinschaft eingearbeitet hatten, klingelte es. Dann stand Anne in der Tür. Sie sah zu mir hin mit einem so vorwurfsvollen Blick, wie ich ihn nie zuvor und auch nie danach in meinem Leben im Angesicht eines Menschen wahrgenommen habe. Sie sagte kein Wort. Warum ich nicht auf sie gewartet hatte, wollte sie gar nicht wissen. Da gab es nichts zu erklären, nichts auf der Welt hätte meinen frevelhaften Akt der Untreue rechtfertigen können, und auch dafür, daß ich mich jetzt nicht einfach vom Erdboden verschlingen ließ, gab es keine Entschuldigung.
Ein halber Samstag Studium der Politischen Ökonomie ist überaus anstrengend und erschöpfend. Um acht Uhr wurde was von der Pommesbude geholt und um viertel nach acht kam im Fernsehen ein Miss-Marple-Film. Den sahen wir uns an, das mußte einfach sein. Anne aß nichts und schaute völlig desinteressiert auf den Fernsehbildschirm. Ebensogut hätte sie anderthalb Stunden lang vor einem ausgeschalteten Fernsehapparat sitzen können.
Als wir etwa um zehn Uhr das Haus verließen, hatte ich erstmals wieder Gelegenheit, mit dieser Unerbittlichen Worte zu wechseln. Ich war darauf gefaßt, die halbe oder die ganze Nacht damit zuzubringen, sie zu besänftigen, hoffte aber, auf dem kurzen Weg zum Taxistand am Osteingang des Hauptbahnhofs die Sache halbwegs geradebiegen zu können. Denn ich wollte in der Nacht noch „Nummer Sechs“ sehen. Das war eine TV-Serie, die war noch schräger und abgefahrener als „Mit Schirm, Charme und Melone“, noch undurchsichtiger und mit psychedelischem Anhauch. Und an jenem Tag sollte der letzte Teil kommen, in dem sich alles auflöst. Würde es mir gelingen, meine Anne zurückzugewinnen und mich dann noch rechtzeitig allein vor den Fernsehapparat zu setzen? Heutzutage, wo man alles auf Video aufzeichnen kann, erscheint einem eine solche Überlegung vielleicht unvorstellbar.
Immerhin: sie öffnete den Mund. Und sie erklärte, daß sie ja vielleicht mal darüber nachdenken könne, ob sie es sich vielleicht überlegt, vielleicht in Betracht zu ziehen, es vielleicht doch noch mal mit mir zu versuchen. Sie gestattete mir sogar, im Taxi mitzufahren. Mehr war an diesem Abend wirklich nicht mehr rauszuholen.
aus Der Gartenoffizier. 124 komische Geschichten. Situationspresse 2008. 268 S. 16,50 Euro. ISBN 978-3-935673-24-2
P.S.: Als Anne diese Geschichte las, machte sie mir Vorwürfe. Sie war richtig ungehalten: „Das stimmt doch gar nicht! So habe ich dich nie behandelt! Ich war zu dir nie ungehalten, und ich habe dir nie Vorwürfe gemacht! Wie konntest du nur sowas schreiben? Ich fasse es nicht! Was bist du überhaupt für ein Mensch?“
Betrachtungen zum Bikini an Bushaltestellen
Nein: „Betrachtungen an Bushaltestellen zum Bikini“ muß es heißen.

Die Reklame, die jetzt wieder an jedem zweiten Bushaltestellenwartehäuschen zu sehen ist, verstehe ich nicht. „Gutgebaute“ junge Damen im Bikini. Angepriesen und mit Preisangabe versehen wird aber nur das Bikini-Top!

Per definitionem – und das wird durch das Bild durchaus bestätigt – besteht der Bikini als zwei Teilen.
Wir durften eine Zeit erleben, in der alles in Frage gestellt wurde – so auch die Zweiteiligkeit des Bikinis. Plötzlich gab es Bikinis, die nur noch aus einem Teil bestanden, nämlich dem unteren. Der obere Teil wurde ersatzlos abgestreift! „Oben ohne“ nannte man das.
Sind aus der Oben-ohne-Ära vielleicht viele Tops ungenutzt liegengeblieben, die jetzt an die Frau gebracht werden müssen? Müssen die sich den Unterteil dann selber stricken?
Daß sich als neue Mode eine Bikini-Variante durchsetzt, die nur noch aus dem Oberteil besteht, will ich nicht hoffen! Ein solcher „Bikini“ würde ein disproportionales Bild erzeugen! Ein Bikini nur aus einem Oberteil bestehend? Nein, das sieht nicht aus. Wenn der untere Teil verschwunden ist, muß der obere Teil schon vorher verschwunden sein. Denn bei der Entkleidung in erotischem Kontext ist die Reihenfolge von entscheidender Bedeutung.
Den Damen, die Wert darauf legen, daß man ihren nackten Hintern sieht, steht zu diesem Behufe als vortreffliches Hilfsmittel der Tanga zur Verfügung. Der ist – wegen des Stoff-Winkels – weitaus wirksamer als etwa der G-String, der ebenfalls ein disproportionales Bild erzeugt, weil er die Körperlinien an unpassender Stelle unterbricht (ich kann die Dinger nicht leiden).
Noch irritierender finde ich Darstellungen von nackten Frauen, die Schuhe tragen (hochhackig). Ganz nackig, aber noch Schuhe an? Da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin! Wollen die nackig auf die Straße gehen?
Hören Sie die Erinnerungen eines schüchternen, aber genußfähigen Erdenmannes:
Es ist gelegentlich vorgekommen, daß Frauen sich vor mir ausgezogen haben. Sie taten es, um mir eine Freude zu machen – und auch zu ihrem eigenen Vergnügen. Sie waren nicht alle miteinander bekannt und können sich folglich auch nicht abgesprochen haben. Aber bei ausnahmslos allen begann die Entkleidung damit, daß sie sich die Schuhe auszogen. Eine nackte Frau mit Schuhen an den Füßen habe ich in natura noch nie gesehen.
Und bei ausnahmlos allen endete die Entkleidung nie mit dem BH. Der BH war immer spätestens das vorletzte Kleidungsstück, das abgelegt wurde, und jedesmal kam erst zuallerletzt der Hintern zum Vorschein.
Und so ist das auch richtig.










