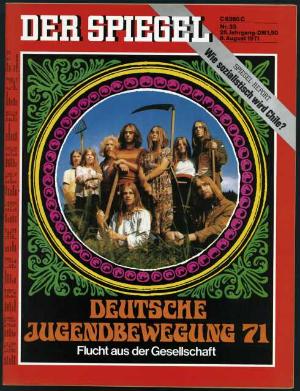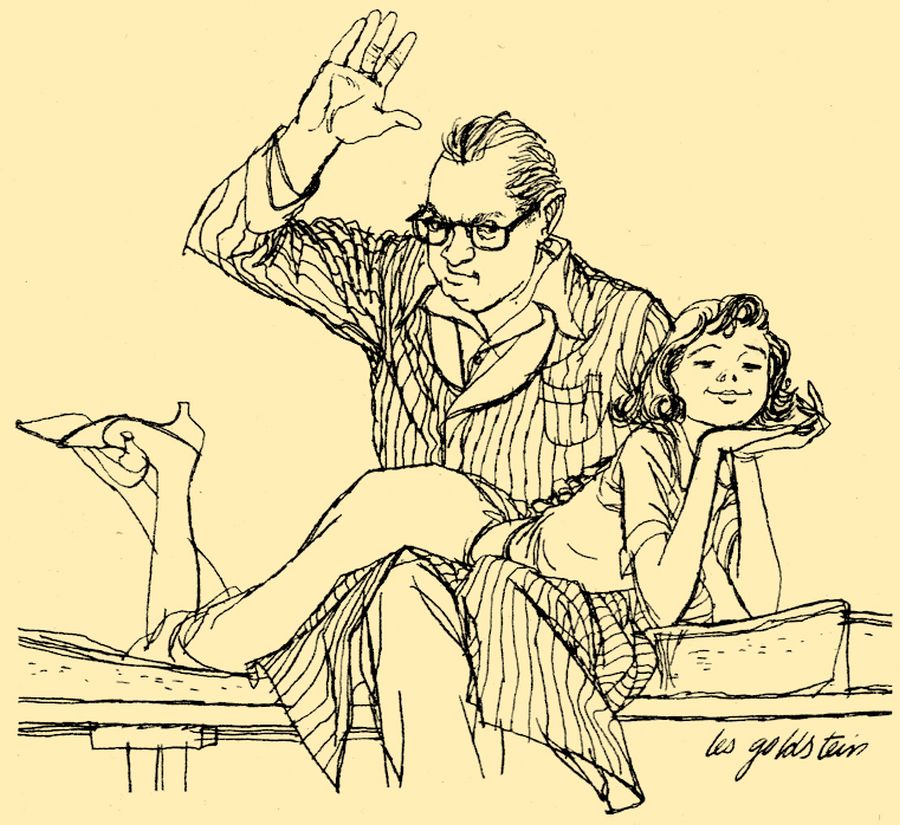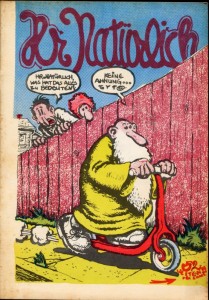Das war gar nicht im Jahre 1969, fällt mir gerade ein. Das war im Jahre 1970, und zwar im Februar. Es hätte aber auch im Jahre 1969 sein können, dann aber im November, denn im November ist ein ähnliches Wetter wie im Februar. Jedenfalls ging man damals mit den Samstagen um, als gäbe es genug davon.
Wir waren an diesem Samstag am frühen Nachmittag verabredet, um uns in die Politische Ökonomie einzuarbeiten. Das wurde „Schulung“ genannt. Die „Schulung“ sollte stattfinden bei Dietmar Ernst, also in Neudorf. Der Dietmar Ernst paßte in unsere KPD/ML-Gruppe genauso wenig hinein wie die meisten von uns. Leute wie ihn pflegte man als „zornige junge Männer“ zu bezeichnen. Er war ein paar Jahre älter als ich, wohl schon Mitte 20, trug wie fast alle männlichen KPD/ML-Mitglieder dieses Alters einen Stalin-Schnurrbart, war wirklich ein „zorniger junger Mann“, lachte nie, brachte aber unentwegt andere zum Lachen mit seinen kunstvoll vorgetragenen Sarkasmen. Er wohnte auf der Blumenstraße in einem riesigen Altbau (Foto) im Dachgeschoß, das ebenfalls riesig war, bestehend aus sehr vielen kleinen Zimmern.

Wir hatten uns also zu fünft dort eingefunden, vier Männer und eine Frau. Anne fehlte noch. Sie wollte etwas später kommen. Ich sollte sie zur verabredeten Zeit von der Straßenbahnhaltestelle abholen.
Anne war meine Freundin. Sie war die hübscheste von allen. Sie hatte wunderschönes langes dunkelbraunes Haar. Jedem gefiel sie, mancher begehrte sie, aber mich hatte sie erhört. Niemand hatte gewußt, daß ich in sie verliebt war, aber alle hatten gewußt, daß sie in mich verliebt war, bloß ich nicht. Wir haben dann aber doch zueinander gefunden und waren ein richtiges Traumpaar.
Anne war sehr gescheit und von unbändiger Neugier auf alles, was man wissen und erfahren kann. Man hätte ihr über alles mögliche etwas erzählen können, über Astronomie, über Geologie oder über isländische Literatur – sie hätte sich das alles aufmerksam angehört.
Sie hatte eine Schwäche: Sie hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Den Weg von ihrer Haustür zur Straßenbahnhaltestelle fand sie zwar, auch gelang es ihr, an der richtigen Station aus der Bahn auszusteigen. Aber den Weg von der Haltestelle Neudorfer Straße zur Blumenstraße (etwa hundert Meter geradeaus) konnte sie nur finden, wenn man sie an der Hand nahm und führte. Sie hatte mir eingeschärft, sie zur verabredeten Zeit an der Haltestelle abzuholen.
Ich ging also zur Haltestelle. Aus der Bahn, mit der sie kommen wollte, stieg sie aber nicht aus. Sie wird sie wohl verpaßt haben, dachte ich, und wartete auf die nächste. Mit der nächsten kam Anne auch nicht, auch nicht mit der übernächsten. Es wurde ein langes Warten.
Während ich wartete, fand sich an der Haltestelle ein alter Mann ein, der – das war leicht zu vermuten – zu denen gehörte, die über keine Wohnadresse verfügen. Sein Mantel war sehr abgetragen, die zahlreichen Plastiktüten, die er mit sich trug, enthielten wohl all seine Habseligkeiten. Auf dem Haupt hatte er kaum noch Haare, dafür hatte er einen langen Bart. Für die Comic-Figur „Herr Natürlich“ von Robert Crumb hätte er das Modell sein können.
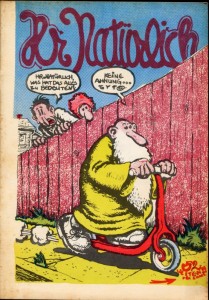
Als die nächste Straßenbahn eintraf, begann er, hastig die Plastiktüten aufzuheben. Als dann endlich all seine Tüten hochgehoben waren, war die Bahn schon abgefahren, und er ließ sie wieder zu Boden sinken. Das wiederholte sich noch ein paar mal. Nie war er schnell genug mit dem Zusammenraffen der Tüten, immer fuhr die Bahn ohne ihn ab. Mir fiel auf, daß die Bahnen, in die mit seinen Tüten einzusteigen er nie schaffte, von verschiedenen Linien waren und auf verschiedenen Wegen zu verschiedenen Stationen fuhren. Er wollte mit der Straßenbahn wegfahren, und es kam ihm offensichtlich nicht darauf an, mit welcher und wohin.
Nachdem er auf diese Weise wohl schon ein halbes Dutzend Straßenbahnen verpaßt hatte, begann er, mit durchdringender Stimme und in erheblicher Lautstärke ein Lied zu singen, das auch nach der vierzigsten Strophe noch nicht zu Ende war. Der Text war dermaßen bescheuert, daß er nur selbstgedichtet gewesen sein konnte. Die erste Zeile lautete:
„Was ist das Leben heut‘ so schwer! Man findet keine Ruhe mehr!“
Die Botschaft des Liedes läßt sich etwa so zusammenfassen: Wie man es auch dreht und wendet, das Leben bringt doch nur Verdruß.
„Hast du einen kleinen Laden, hast du auch so deine Plagen!“
Die beiden älteren Damen, die da auch auf eine Straßenbahn warteten, sagten zwar nichts, aber die Indigniertheit über den lautstarken Balladenvortrag war ihnen anzumerken. Als der Sänger dessen gewahr wurde, stellte er sich vor eine der beiden Damen hin, nahm eine Boxerstellung ein, tänzelte mit erhobenen Fäusten vor ihr hin und her und ließ die Fäuste durch die Luft sausen, immer die Nase der Dame knapp verfehlend. Die Damen waren fassungslos über das Geschehen. Weniger fürchteten sie sich, von einem Boxhieb getroffen zu werden. Aber es war ihnen furchtbar unangenehm, daß da einer sich dermaßen aufführte.
Ich verbrachte wohl eine Stunde an der Haltestelle und entfernte mich dann, so daß ich nicht weiß, wie die Geschichte mit den vergeblichen Abreiseversuchen ausging, und ich Ihnen nicht sagen kann, welche Wendung schließlich dazu führte, daß der Mann mit seinen Tüten jetzt nicht mehr an der Haltestelle steht. Anne war nicht gekommen; es wird ihr wohl – so vermutete ich – etwas dazwischengekommen sein. Ich ging also wieder dorthin, wo nun mit Verspätung die Schulung auf der Grundlage des Lehrbuchs der Politischen Ökonomie (Dietz-Verlag 1955) beginnen sollte.
Als wir uns in das Studium der Produktionsweise in der Urgemeinschaft eingearbeitet hatten, klingelte es. Dann stand Anne in der Tür. Sie sah zu mir hin mit einem so vorwurfsvollen Blick, wie ich ihn nie zuvor und auch nie danach in meinem Leben im Angesicht eines Menschen wahrgenommen habe. Sie sagte kein Wort. Warum ich nicht auf sie gewartet hatte, wollte sie gar nicht wissen. Da gab es nichts zu erklären, nichts auf der Welt hätte meinen frevelhaften Akt der Untreue rechtfertigen können, und auch dafür, daß ich mich jetzt nicht einfach vom Erdboden verschlingen ließ, gab es keine Entschuldigung.
Ein halber Samstag Studium der Politischen Ökonomie ist überaus anstrengend und erschöpfend. Um acht Uhr wurde was von der Pommesbude geholt und um viertel nach acht kam im Fernsehen ein Miss-Marple-Film. Den sahen wir uns an, das mußte einfach sein. Anne aß nichts und schaute völlig desinteressiert auf den Fernsehbildschirm. Ebensogut hätte sie anderthalb Stunden lang vor einem ausgeschalteten Fernsehapparat sitzen können.

Anne mit 15, hier sehr freundlich
Als wir etwa um zehn Uhr das Haus verließen, hatte ich erstmals wieder Gelegenheit, mit dieser Unerbittlichen Worte zu wechseln. Ich war darauf gefaßt, die halbe oder die ganze Nacht damit zuzubringen, sie zu besänftigen, hoffte aber, auf dem kurzen Weg zum Taxistand am Osteingang des Hauptbahnhofs die Sache halbwegs geradebiegen zu können. Denn ich wollte in der Nacht noch „Nummer Sechs“ sehen. Das war eine TV-Serie, die war noch schräger und abgefahrener als „Mit Schirm, Charme und Melone“, noch undurchsichtiger und mit psychedelischem Anhauch. Und an jenem Tag sollte der letzte Teil kommen, in dem sich alles auflöst. Würde es mir gelingen, meine Anne zurückzugewinnen und mich dann noch rechtzeitig allein vor den Fernsehapparat zu setzen? Heutzutage, wo man alles auf Video aufzeichnen kann, erscheint einem eine solche Überlegung vielleicht unvorstellbar.
Immerhin: sie öffnete den Mund. Und sie erklärte, daß sie ja vielleicht mal darüber nachdenken könne, ob sie es sich vielleicht überlegt, vielleicht in Betracht zu ziehen, es vielleicht doch noch mal mit mir zu versuchen. Sie gestattete mir sogar, im Taxi mitzufahren. Mehr war an diesem Abend wirklich nicht mehr rauszuholen.
aus Der Gartenoffizier. 124 komische Geschichten. Situationspresse 2008. 268 S. 16,50 Euro. ISBN 978-3-935673-24-2
P.S.: Als Anne diese Geschichte las, machte sie mir Vorwürfe. Sie war richtig ungehalten: „Das stimmt doch gar nicht! So habe ich dich nie behandelt! Ich war zu dir nie ungehalten, und ich habe dir nie Vorwürfe gemacht! Wie konntest du nur sowas schreiben? Ich fasse es nicht! Was bist du überhaupt für ein Mensch?“